Die Kontaktallergie auf Formaldehyd entwickelte sich durch die industrielle Fertigung täglicher Gebrauchsgegenstände wie Bekleidung, Kosmetika oder Kunststoff besonders in den siebziger Jahren. Heute ist die allergene Belastung der Bevölkerung auf etwa zwei Prozent zurückgegangen. Die Allergie kann mit einem Epikutantest nachgewiesen werden.
Formaldehyd in Lacken, Kunststoff und Kosmetika
Formaldehyd wird in der Industrie als gängiges Konservierungsmittel verwendet. Mit Formaldehyd wird das Produkt haltbarer und formbeständiger. Eine mangelhafte statistische Datenlage lässt zurzeit noch keine umfassende Einschätzung der gesundheitlichen Gefährdung von Formaldehyd zu. Für tolerierbare Obergrenzen in allen industriellen Bereichen gelten gesetzliche Verordnungen.
Allergische Reaktionen auf Formaldehyd
Formaldehyd irritiert die Haut und die Schleimhäute bis hin zu Allergien vom Soforttyp sowie vom verzögerten Typ, je nach Sensibilisierung. Als Desinfektionsmittel in der Medizin selbst gegen Viren sehr wirksam, findet die chemische Substanz in der Bekleidungs-, der Lebensmittel-, der Chemie- und der Tabakindustrie umfassend Verwendung. Insgesamt ist die Verwendungsbreite eher rückläufig – Formaldehyd wird zunehmend durch andere Konservierungsmittel ersetzt. Besonders jedoch bei Hausfrauen, Rauchern und bei Menschen, die mit Desinfektionsmitteln, Kühlschmiermitteln, Farben, Lacken und Klebern zu tun haben, kann noch mit möglichen allergischen Reaktionen gerechnet werden.
Formaldehyd in der Umwelt
Der vielfältige Einsatzbereiches dieses chemischen Konservierungsstoffes macht es fast unmöglich, den körperlichen Kontakt mit Formaldehyd zu vermeiden. Kunststoffe, Papier und Karton, Farben und Lacke, Bekleidung und Kosmetika – ja selbst Lebensmittel und Spielzeug – bleiben von Formaldehyd nicht verschont. Sogar Zigarettenrauch enthält nennenswerte Mengen an Formaldehyd. Selbst Gemüse und Obst, Fisch und Gefrierprodukte enthalten bis zu 500 mg/kg Formaldehyd. Im Blut eines normalen Menschen wurden 0,14 mg/kg festgestellt. Eine Studie an Ratten fand heraus, dass ab einer Konzentration von 50 mg/kg Entzündungen im Gewebe auftreten – vorher nicht. Also keine Panik: Die Wissenschaft spricht von geringer Toxizität und hinsichtlich des Kontaktekzems von klinisch nicht relevant.
Photo © Dieter Schütz / PIXELIO






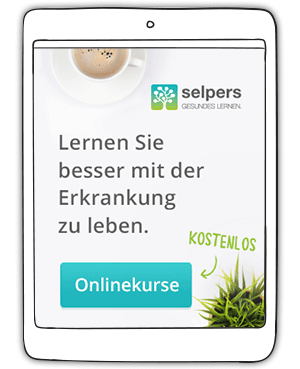





Kommentare zu diesem Thema beendet.